Willkommen in der
Planckwelt
X17 und das Dunkle Elektron
9.
Interview in Hannover
IZ:
Ein neues Teilchen mit dem Namen X17 ruft
weltweite Aufmerksamkeit hervor, ein Jahrzehnt nach dem Nachweis des Higgsbosons am LHC. Das Higgs-Boson
zerfiel innerhalb von 10^-22s u.a. in zwei Photonen. Deren Zerfall in Elektron
und Positronpaare
wurde von den Detektoren im Winkel von 180 ° nachgewiesen. Das Standardmodell ist jetzt mit dem Higgs-Boson komplett. Die Suche nach den ersten Teilchen
der Supersymmetrie war bis jetzt ergebnislos.
Wie ist es jetzt zu dem Hype um das Teilchen X17 als ein lang ersehntes
neues Teilchen seit 2012 gekommen?
Autor:
Am kernphysikalischen Institut Atomki der
Akademischen Wissenschaften in Ungarn wurde Lithium-7 mit Protonen beschossen.
Das entstandene angeregte radioaktive Beryllium-8 sendete Gammastrahlung aus,
die in Elektron- und Positronpaare
zerfiel. Eine besonders starke zusätzliche Emission wurde beim Winkel 140° beobachtet. Das ist eine
Anomalie, die mit dem Standardmodell nicht erklärt werden kann. Der
Ablenkwinkel von 140 ° zwischen Elektronen und Positronen kann nur mit einem
neuen kurzlebigen Teilchen mit einer Masse von 17 MeV erklärt werden. Die ersten Versuchsergebnisse
in 2016 wurden nicht ernst genommen und auf Messfehler
zurückgeführt. Als beim Zerfall von radioaktiven Heliumkernen-4, die durch den
Beschuss von Tritium entstanden, ebenfalls ein kurzlebiges Teilchen mit der
Masse von 17 MeV detektiert wurde, begann nach der
Veröffentlichung des ungarischen Teams am Atomki der Hype um das X17. Dieses Teilchen zerfiel
in Elektron- und Positronpaare im Winkel von
115°. Jetzt wurde auch am CERN die Jagd
nach dem X17 eröffnet. Der Detektor LHCb wird zur Zeit umgebaut. Erste Ergebnisse wird
2023 erwartet.
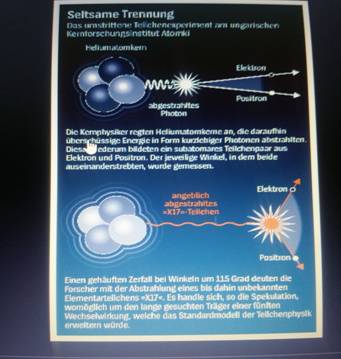
Bildquelle: Spiegel
IZ:
Ist das X17 ein Teilchen oder ein Boson, das auf eine 5. Kraft hinweist? Ist das X17 ein Teilchen des
Standardmodells?
Autor:
Im Standardmodell können die Massen der Elementarteilchen zwar gemessen werden,
ihre Werte können aber allgemein nicht erklärt und berechnet werden. Im rechten
Diagramm haben die logarithmisch aufgetragenen Massen die Quantenzahlen 0,1,2,3,5. Die Massen der Quarks und geladenen
Leptonen haben auf den 4 Geraden mit
unterschiedlichen Rotationswinkeln gleiche Abstände. Sie sind
skalensymmetrisch. Die Familienzahlen sind Quantenzahlen. Im Standardmodell
wird die Gravitation gegenüber der elektromagnetischen Kraft vernachlässigt.
Beim Proton und Elektron ist das Verhältnis 10^-36 ist. Wasserstoffatome ziehen sich am Rande der Galaxien durch die Gravitation
deshalb zu Wasserstoffwolken zusammen, weil sich die anderen Ladungen durch die
Erhaltungssätze aufheben. Wasserstoffwolken verdichten sich durch die Gravitation
zu Sternen.
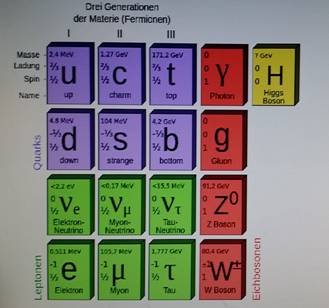
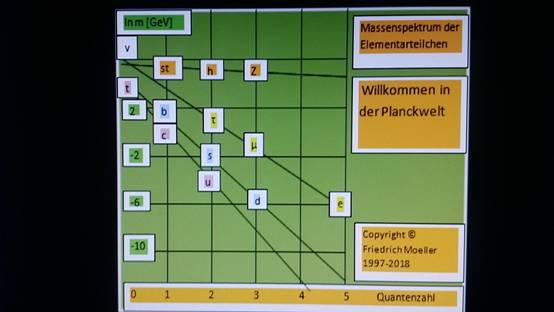
Die Rotationswinkel der 4 Geraden sind nicht beliebig sondern durch
die SO(4)- Symmetrie festgelegt. Die SO(4)-Symmetrie enthält eine 3D-Rotation
und eine Translation in Form eines
Ellipsoids.
Für die massiven Eichbosonen gilt beim Vakuumerwartungswert v=246 GeV :
H Z m
= v e^ ( -e°/3 n ) n = 2,3
Für die geladenen Leptonen gilt :
τ μ e m = v e^(+ e^-2/3 –e
n ) n=2,3,5
Für das hypothetische X17 – Teilchen gilt:
X17 m= 2 v e^( + e^-2/3 - e n ) n= 4
Für die Quarks gilt:
b s d m = v
e^ ( -1/3
- e²/2 n
) n = 1,2,3
t c u m
= v e^ ( -1/3 -2 e²/3
n
) n
= 0,1,2
Die Familienzahlen sind Quantenzahlen .
Die Rotationswinkel der Geraden sind eine
Funktion der Eulerschen
Zahl e ab. Die Geraden sind längs der ln
m –Achse verschoben.
Bosonen, Quarks und geladene Leptonen haben damit unterschiedliche Vakuumerwartungswerte. Erstaunlicherweise ist
bei den geladenen Leptonen die Quantenzahl 4 nicht
besetzt. Sie entspricht einer Masse von 7.8 MeV . Zusammen mit dem
Antiteilchen erhalten wir eine Ruhemasse
von 15.6 MeV, die zusammen mit der kinetischen
Energie der Masse des X17 nahekommt. Das obige Diagramm (Quelle: Spiegel ) zeigt die seltsame Trennung der beiden
unterschiedlichen Prozesse. Das angeregte Heliumatom
strahlt Gamma-Strahlung ab. Die Photonen zerfallen anschließend in Elektron-
und Positronpaare. Der Winkel ist mit dem
Standardmodell vereinbar. In einem millionstel der
Fälle wird erst das X17 – Teilchen abgestrahlt, das dann im Winkel von 115 °
in Elektron- und Positron – Paare
zerfällt. Der Strahlwinkel 115° kann durch das Standardmodell nicht erklärt
werden. Das ist das eigentliche Problem!
IZ:
Ist das F17 ein neues Teilchen oder ist es das Dunkle Boson
als Träger einer 5. Kraft, wie es das
Team von Atomki behauptet?
Autor:
Das Photon ist ein Boson
und das Austauschteilchen der elektromagnetischen Kraft. Mit der typischen
Frequenz wechselt es ohne Ruhemasse zwischen negativer und positiver
elektrischer Ladung. Das Z-Boson ist neben den beiden elektrisch geladenen W-Bosonen
ein Austauschteilchen der schwachen Kraft. Wegen der kurzen Reichweite hat es ein Ruhemasse von 91 GeV und wird
auch schweres oder Dunkles Photon genannt.
Damit haben wir aber noch keinen Bezug zur Dunklen Materie und zu einer 5. Kraft. Wir können das F17 auch als einen angeregten
Übergangszustand ansehen, der aus einem Teilchen mit der 15 mal größeren Masse
des Elektrons und dem entsprechenden
Anti-Teilchens besteht und Exziton genannt wird. Nach
kurzer Zeit zerfällt das Exziton in ein Elektron und
ein Positron, die von den Detektoren
erfasst werden. Wie können mit dem Exziton die
unterschiedlichen Abstrahlwinkel 140 ° und 115° erklärt werden
? Die Gammastrahlung breitet sich
mit der Lichtgeschwindigkeit c aus. Für Teilchen mit einer Masse gilt hingegen
v<c . Wir hatten vor 100 Jahren ein ähnliches
Problem mit der Energie- und Impulserhaltung bei der schwachen Wechselwirkung.
Damals postulierte Pauli ein neues Teilchen, das Neutrino, das später auch
nachgewiesen werden konnte. Die Berechnung im Rahmen des Standardmodells mX17 = 2 v
e^( e^-2/3 – 4
e ) legt
nahe, dass das X17 ein Exziton ist. Die Masse des negativ geladenen Teilchens des Exzitons liegt zwischen der Masse des Myons und der Masse
des Elektrons und gehorcht der Skalensymmetrie. Für den zum Strahlwinkel 115°
gehörenden Impuls wird das massive kurzlebige Exziton
benötigt. Es stellt sich jetzt die spannende Frage: Gibt es das 4. geladene Lepton ? Gibt es das Dunkle Elektron ?
Abweichungen von der Universalität der Leptonen
beim Zerfall des Tauons und das abweichende
magnetische Moment des Myons sind mit dem Standardmodell nicht zu erklären. Auch sie geben einen
Hinweis auf ein 4. geladenes Lepton.
IZ:
Das Exziton ist ein außergewöhnliches Teilchen und
besteht aus zwei Teilchen mit kurzzeitig getrennten Ladungen und ist eine alternative Erklärung für das
X17 Teilchen. Gibt es für das Exziton ein
anschauliches Beispiel aus der Natur.
Autor:
Das Exziton existiert für die kurze Zeit von 10^-15
s. Mit neu entwickelter
Laser-Flashtechnik werden in diesem Zeitraum auch biochemische Prozesse
verfolgt. Auf diese Weise wird die Photosynthese besser verstanden. Das auf das grüne Chlorophyll auftreffende
Sonnenlicht erzeugt ein Exziton. Innerhalb von 10^-15 s muss das Elektron dem
Reaktionszentrum zugeführt werden. Findet das Elektron das Reaktionszentrum
nicht, vereinigt sich das Elektron mit dem Positron, dem Antielektron, und die
auftreffende Sonnenenergie kann von der Pflanze nicht genutzt werden. In der
Natur erzeugt jedes Photon ein Exciton und daraus
entsteht ein Elektron, das chemisch für die Zuckersynthese gespeichert
wird. Das ist ein Wirkungsgrad von 100
%. Mit unserer Photovoltaik auf
Silizium-Basis sind wir bei 20 %. Die
Natur bedient sich der Quantenmechanik.
Für die Zeit von 10^-15 s ist das Elektron nicht nur ein Teilchen
sondern verhält sich auch wie eine Wahrscheinlichkeitswelle. Es ist gleichzeitig an verschiedenen Orten
und natürlich auch über dem
Reaktionszentrum. Das ist ein
schönes Beispiel für ein Exciton.
IZ:
Was hat das X17 mit der Dunklen Materie zu tun ?
Autor:
Die Existenz der Dunklen Materie ist unbestritten. Kann sie mit den
Elementarteilchen des Standardmodells erklärt werden, oder benötigen wir neue
Teilchen jenseits des Standardmodells? Die Hoffnung, mit dem LHC erste
supersymmetrische Teilchen zu finden, ist inzwischen gering geworden. Das ist
derzeit eines der großen Rätsel der Physik.
Viel Forschungsgeld steht hierfür zur Verfügung. Im Gespräch ist der Future Circular Collider (FCC) , der nächste Teilchenbeschleuniger mit einer Umfangslänge
von 100 km. Die Bewegung der Sterne
inmitten der Wasserstoffwolken am Rande der Galaxis weichen
vom Gravitationsgesetz Newtons ab. Das Gesetz stellte Newton auf, als er vor
der wütenden Pest in London auf das Land flüchtete. Die Geschwindigkeit der Wasserstoffwolken und der
Sterne ist so groß, dass sie eigentlich
aufgrund der hohen Fliehkraft ins All geschleudert werden müssten. Die Wasserstoffatome müssen 4 bis 6 Mal so
schwer sein, um die Gravitation zu erzeugen,
die die Sterne auf ihrer beobachteten Bahn hält. Diese Gravitation wird der Dunklen Materie
zugesprochen. Würde Wasserstoff aus den Quarks und dem Lepton
der 2. Familie {ccs µ} bestehen, wäre er 4 mal so schwer wie
normaler Wasserstoff und würde die Gravitation erzeugen, die der Dunklen
Materie zugeschrieben wird. Am LHC wurde 2017 das Xi-Teilchen
mit zwei schweren charm-Quarks {ccu++}
nachgewiesen. Wenn es am LHC gelingen
sollte, auch das Xi-Teilchen {ccd+} zu erzeugen,
erhielten wir ein dunkles Proton und damit einen dunklen
Wasserstoffkern. Wir bräuchten dann
keine neuen exotischen Teilchen für die Dunkle Materie.
IZ:
Das sind interessante Gedanken zur Dunklen Materie, die die 2. Teilchenfamilie
mit einbezieht. Die 2. Teilchenfamilie unterscheidet sich von der 1.
Teilchenfamilie, die wir kennen, nur durch die unterschiedlichen Massen. Wir
können das X17- Teilchen als Exziton, bestehend aus
einem Dunklen Elektron und einem Dunklen Anti-Elektron, in die Struktur der
Massen des Standardmodells einordnen.
Dunkle Materie besteht aus Xi-Teilchen, die
wir als schwere Protonen aus den Quarks der 2. Familie auffassen können und
einem eingefangenen Dunklen Elektron. Wie lässt sich das mit den ultrakurzen
Lebensdauern der Teilchen unter den Laborbedingungen des LHC vereinbaren?
Autor:
Der LHC arbeitet bei den tiefen Temperaturen der supraleitenden Magneten. Die
Sterne am Galaxienrand sind von heißen Gaswolken umgeben. Das Röntgenteleskop
des Satelliten Planck hat
Gastemperaturen von über einer Million
°K gemessen. Bei dieser Temperatur kann
Dunkler Wasserstoff durchaus existieren. Unsere Phantasie wird immer noch
beflügelt von der Zerstrahlung von
Materie und Antimaterie, von Wasserstoff
und Antiwasserstoff. Die Suche nach Antimaterie auf der ISS hat außer einigen Tausend Positronen
keinerlei Hinweise auf Antiwasserstoff gebracht. Am CERN konnte Antiwasserstoff nur mit großem
Aufwand erzeugt werden. Starke Magnetfelder mussten die wenigen Moleküle von
der Behälterwand fernhalten. Die Dunkle
Materie bringt eine neue Perspektive.
Steht uns mit der Erzeugung von Dunklem Wasserstoff, mit dem Speichern
und dem kontrollierten Zerfall des Dunklen Wasserstoffs in normalen Wasserstoff
eine neue Energiequelle zur Verfügung ?
IZ:
In Zusammenhang mit dem X17 Teilchen wird immer wieder von der 5. Kraft
gesprochen. Gibt es eine 5. Naturkraft, zusätzlich zur Gravitationskraft, zur
elektromagnetischen Kraft und den beiden Kernkräften.
Autor:
Es gibt diese 5. Naturkraft und diese 5. Kraft hält uns zur
Zeit weltweit in Atem. Diese
Kraft müssen wir verstehen, wenn wir sie bekämpfen wollen und müssen. Eine
Kraft beruht immer auf einer Polarität. Beim Virus ist das die Polarität
zwischen polarisiertes Licht linksdrehende und rechtsdrehende asymmetrische Kohlenstoffverbindungen.
Wenn wir die Symmetrie dieser Kraft verstehen, dann gewinnen wir Zeit, die wir für den Kampf so dringend
benötigen.
Gibt es die
Urkraft?
copyright © Friedrich Moeller 1997-2020 email:
f.moeller@necnet.de